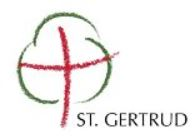KIRCHENMUSIK
 St. Antonius, Front-Rosette, Hl. Cäcilia, Patronin der Kirchenmusik
St. Antonius, Front-Rosette, Hl. Cäcilia, Patronin der Kirchenmusik
Musica sacra und Liturgie
Die kultische Musik findet ihre theologische Grundlegung im Wesen der göttlichen Liturgie selbst. Das II. Vaticanum sagt in seiner Liturgiekonstitution, daß „der mit dem Wort verbundene heilige Gesang einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht“ (Artikel 112).
Aus dem Glaubensschatz der betenden Kirche hat das II. Vaticanum in seiner Liturgiekonstitution wichtige Aussagen über das Wesen der Liturgie festgehalten. So heißt es in Artikel 5: „Die Fülle des göttlichen Kultes“ ist uns im Erlösungswerk Christi geschenkt, insbesondere im Pascha-Mysterium, „denn aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus ist uns das wunderbare Sakrament der ganzen Kirche hervorgegangen“ (5, 2).
„Seither hat die Kirche niemals aufgehört, sich zur Feier des Pascha-Mysteriums zu versammeln ... die Eucharistie zu feiern, in der Sieg und Triumph seines Todes dargestellt werden, und zugleich Gott für die unsagbar große Gabe dankzusagen (2 Kor 9, 15) in Christus Jesus zum Lobe seiner Herrlichkeit (Eph 1, 12). Aber all das geschieht in der Kraft des Hl. Geistes“ (Art. 6).
In diesem Werk Christi inter nos ist er immerdar gegenwärtig, ob die Kirche betet oder psalliert. Im Werk des gegenwärtigen Christus wird „Gott vollkommen verherrlicht und die Menschheit geheiligt“ (Art. 7).
Die Liturgie ist „Werk Christi, des Priesters, und seines Leibes, der Kirche, und deshalb in vorzüglichem Sinn heilige Handlung“ (actio sacra praecellenter... Art. 7). Um des gegenwärtigen und die Liturgie vollziehenden Herrn willen wächst allem menschlichen Dienst in der Liturgie eine besondere Würde zu, vor allem dem priesterlichen Dienst am Altare, der aber nicht zu lösen ist vom Dienste des Gesanges, mit dem und durch den die irdische Liturgie sich mit der himmlischen Liturgie vereint. Das II. Vaticanum sagt: „In der irdischen Liturgie singen wir dem Herrn mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit“ (Art. 8).
Diese Einswerdung von himmlischer und irdischer Liturgie ist aber auch nur möglich, weil im Gottmenschen Jesus Christus Himmel und Erde einen neuen Bund geschlossen haben, und weil die durch die Erbsünde zerstörte Harmonie in Ihm wiederhergestellt worden ist. Die ganze Realität dieses Chorus aus singenden Geistern und uns armen Erdenpilgern erleben wir in unserer wahrhaft göttlichen Liturgie, wenn wir beten dürfen: Durch ihn, mit ihm und in ihm wird dir, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Ehre und Verherrlichung von Ewigkeit zu Ewigkeit...
Oder wenn wir direkt einstimmen dürfen in den Gesang der Engel im Gloria und Sanctus der Himmel und Erde umspannenden Liturgie, trotz aller irdischen Trübsal und menschlichen Armseligkeit, die uns umgeben oder gar belasten mag.
Himmlische und irdische Liturgie
Wenn auch ein wesensmäßiger Rangunterschied zwischen himmlischer und irdischer Liturgie besteht, der in der Liturgie selbst erscheinende Herr repräsentiert die himmlische Liturgie, und er ist es, der die Verbindung zu unserer Armut herstellt. Denn nur „durch ihn loben die Engel“ (Praefatio) die Majestät Gottes des Vaters, wie wir hienieden durch ihn zu lebendigen Instrumenten der himmlischen Liturgie werden.
Als Singende bilden die reinen Geister durch Ihn mit uns diese Himmel und Erde umfassende Gemeinschaft. Von hier aus ergibt sich, daß der singende reine Geist Ursprung, Vorbild und endzeitliches Ziel unseres liturgisch-musikalischen Dienstes ist und sein muß. In ihm gründen Würde und Rang der Musica sacra, unabhängig von allen geschichtlichen Veränderungen. Mehr als die übrigen der Liturgie dienenden Künste steht die liturgische Tonkunst in einer direkten Beziehung zur himmlischen Liturgie. So ist sie wirklich eine heilige Musik, Musica sacra, deren Wesen allein vom erlösten und geheiligten Menschen begriffen und gestaltet werden kann. Nur eine heilige Musik ist Gottes würdig.
Deshalb hat die Kirche seit ihren Anfängen immer um die Wahrung der Heiligkeit ihrer Musik ringen müssen. Letztlich ging es immer um das rechte Glaubensverständnis der liturgischen Mysterien, ihres Inhalts und ihres Anspruchs.
Der heilige Pius X., der große Erneuerer der Liturgie und ihrer Musik, verlangt in seinem Motu proprio von 1903 von der liturgischen Musik, daß sie heilig sei: „Daher muß alles Profane nicht nur von ihr selbst, sondern auch von der Art ihrer Auffführung ferngehalten werden“. Und zur der Aufführung gehört auch der Ort. In der Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils ist zu lesen: „So wird denn die Kirchenmusik um so heiliger sein, je enger sie mit der heiligen Handlung verbunden ist.“ Je lebendiger also die Musica sacra in der künstlerischen Aussage ihrer Verkündigung und Anbetung und durch die sie schaffenden und nachschaffenden Musiker und Sänger mit dem heiligen Geschehen, der actio sacra praecellenter, innerlich verbunden ist, um so heiliger ist sie, um so mehr realisiert sie die Herrenbitte: Geheiligt werde dein Name!
Es ergibt sich die logische Konsequenz, im Bewußtsein der Kirche von heute und insbesondere im Bewußtsein der heranwachsenden Priestergeneration (im Welt- und Ordensklerus) die Überzeugung wieder lebendig zu machen, daß die Musica sacra nicht ein Ornament, nicht eine Zutat, nicht eine im Grunde entbehrliche Randverzierung des christlichen Kultes und ganz allgemein der christlichen Frömmigkeit ist, sondern, wie das Konzil sagt, „pars integralis“, wesentlicher Bestandteil, wesensgemäße, hohe festliche Form christlichen Betens. Der Heilige Geist selbst wird in der Sprache der Kirche genannt „Jubilus Patris et Filii“. Eine Liturgie, die auf das pneumatische Lied, auf den „Jubilus“ des hochgestimmten Herzens, auf „das Singen und Spielen im Herrn“ verzichten wollte, wäre nicht nur eine Verkümmerung, sondern geradezu eine Verleugnung ihres eigenen Wesens. Es geht also hier nicht, wie schon gesagt, um irgendwelche bloße Kategorien der Ästhetik, sondern um echte Kategorien der Theologie. Es geht darum, der Musica sacra den ihr gebührenden theologischen Rang wiederzugeben, den sie aus mancherlei Gründen weithin verloren hat.
Erinnern wir nur an das Wort des hl. Ambrosius: Christus in ecclesia cantat. Das im Gottesdienst gesungene Wort wird zum Symbol und zur Erscheinung des göttlichen Logos, dessen Mysterium der Inkarnation sich fortsetzt.
Aus: Johannes Overath, Anmerkungen zur Theologie der Musica sacra: Musica spiritus sancti numine sacra, Beiträge zur Theologie der Musica Sacra, Città del Vaticano 2001, S. 104-112.
Die kultische Musik findet ihre theologische Grundlegung im Wesen der göttlichen Liturgie selbst. Das II. Vaticanum sagt in seiner Liturgiekonstitution, daß „der mit dem Wort verbundene heilige Gesang einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie ausmacht“ (Artikel 112).
Aus dem Glaubensschatz der betenden Kirche hat das II. Vaticanum in seiner Liturgiekonstitution wichtige Aussagen über das Wesen der Liturgie festgehalten. So heißt es in Artikel 5: „Die Fülle des göttlichen Kultes“ ist uns im Erlösungswerk Christi geschenkt, insbesondere im Pascha-Mysterium, „denn aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus ist uns das wunderbare Sakrament der ganzen Kirche hervorgegangen“ (5, 2).
„Seither hat die Kirche niemals aufgehört, sich zur Feier des Pascha-Mysteriums zu versammeln ... die Eucharistie zu feiern, in der Sieg und Triumph seines Todes dargestellt werden, und zugleich Gott für die unsagbar große Gabe dankzusagen (2 Kor 9, 15) in Christus Jesus zum Lobe seiner Herrlichkeit (Eph 1, 12). Aber all das geschieht in der Kraft des Hl. Geistes“ (Art. 6).
In diesem Werk Christi inter nos ist er immerdar gegenwärtig, ob die Kirche betet oder psalliert. Im Werk des gegenwärtigen Christus wird „Gott vollkommen verherrlicht und die Menschheit geheiligt“ (Art. 7).
Die Liturgie ist „Werk Christi, des Priesters, und seines Leibes, der Kirche, und deshalb in vorzüglichem Sinn heilige Handlung“ (actio sacra praecellenter... Art. 7). Um des gegenwärtigen und die Liturgie vollziehenden Herrn willen wächst allem menschlichen Dienst in der Liturgie eine besondere Würde zu, vor allem dem priesterlichen Dienst am Altare, der aber nicht zu lösen ist vom Dienste des Gesanges, mit dem und durch den die irdische Liturgie sich mit der himmlischen Liturgie vereint. Das II. Vaticanum sagt: „In der irdischen Liturgie singen wir dem Herrn mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit“ (Art. 8).
Diese Einswerdung von himmlischer und irdischer Liturgie ist aber auch nur möglich, weil im Gottmenschen Jesus Christus Himmel und Erde einen neuen Bund geschlossen haben, und weil die durch die Erbsünde zerstörte Harmonie in Ihm wiederhergestellt worden ist. Die ganze Realität dieses Chorus aus singenden Geistern und uns armen Erdenpilgern erleben wir in unserer wahrhaft göttlichen Liturgie, wenn wir beten dürfen: Durch ihn, mit ihm und in ihm wird dir, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Ehre und Verherrlichung von Ewigkeit zu Ewigkeit...
Oder wenn wir direkt einstimmen dürfen in den Gesang der Engel im Gloria und Sanctus der Himmel und Erde umspannenden Liturgie, trotz aller irdischen Trübsal und menschlichen Armseligkeit, die uns umgeben oder gar belasten mag.
Himmlische und irdische Liturgie
Wenn auch ein wesensmäßiger Rangunterschied zwischen himmlischer und irdischer Liturgie besteht, der in der Liturgie selbst erscheinende Herr repräsentiert die himmlische Liturgie, und er ist es, der die Verbindung zu unserer Armut herstellt. Denn nur „durch ihn loben die Engel“ (Praefatio) die Majestät Gottes des Vaters, wie wir hienieden durch ihn zu lebendigen Instrumenten der himmlischen Liturgie werden.
Als Singende bilden die reinen Geister durch Ihn mit uns diese Himmel und Erde umfassende Gemeinschaft. Von hier aus ergibt sich, daß der singende reine Geist Ursprung, Vorbild und endzeitliches Ziel unseres liturgisch-musikalischen Dienstes ist und sein muß. In ihm gründen Würde und Rang der Musica sacra, unabhängig von allen geschichtlichen Veränderungen. Mehr als die übrigen der Liturgie dienenden Künste steht die liturgische Tonkunst in einer direkten Beziehung zur himmlischen Liturgie. So ist sie wirklich eine heilige Musik, Musica sacra, deren Wesen allein vom erlösten und geheiligten Menschen begriffen und gestaltet werden kann. Nur eine heilige Musik ist Gottes würdig.
Deshalb hat die Kirche seit ihren Anfängen immer um die Wahrung der Heiligkeit ihrer Musik ringen müssen. Letztlich ging es immer um das rechte Glaubensverständnis der liturgischen Mysterien, ihres Inhalts und ihres Anspruchs.
Der heilige Pius X., der große Erneuerer der Liturgie und ihrer Musik, verlangt in seinem Motu proprio von 1903 von der liturgischen Musik, daß sie heilig sei: „Daher muß alles Profane nicht nur von ihr selbst, sondern auch von der Art ihrer Auffführung ferngehalten werden“. Und zur der Aufführung gehört auch der Ort. In der Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils ist zu lesen: „So wird denn die Kirchenmusik um so heiliger sein, je enger sie mit der heiligen Handlung verbunden ist.“ Je lebendiger also die Musica sacra in der künstlerischen Aussage ihrer Verkündigung und Anbetung und durch die sie schaffenden und nachschaffenden Musiker und Sänger mit dem heiligen Geschehen, der actio sacra praecellenter, innerlich verbunden ist, um so heiliger ist sie, um so mehr realisiert sie die Herrenbitte: Geheiligt werde dein Name!
Es ergibt sich die logische Konsequenz, im Bewußtsein der Kirche von heute und insbesondere im Bewußtsein der heranwachsenden Priestergeneration (im Welt- und Ordensklerus) die Überzeugung wieder lebendig zu machen, daß die Musica sacra nicht ein Ornament, nicht eine Zutat, nicht eine im Grunde entbehrliche Randverzierung des christlichen Kultes und ganz allgemein der christlichen Frömmigkeit ist, sondern, wie das Konzil sagt, „pars integralis“, wesentlicher Bestandteil, wesensgemäße, hohe festliche Form christlichen Betens. Der Heilige Geist selbst wird in der Sprache der Kirche genannt „Jubilus Patris et Filii“. Eine Liturgie, die auf das pneumatische Lied, auf den „Jubilus“ des hochgestimmten Herzens, auf „das Singen und Spielen im Herrn“ verzichten wollte, wäre nicht nur eine Verkümmerung, sondern geradezu eine Verleugnung ihres eigenen Wesens. Es geht also hier nicht, wie schon gesagt, um irgendwelche bloße Kategorien der Ästhetik, sondern um echte Kategorien der Theologie. Es geht darum, der Musica sacra den ihr gebührenden theologischen Rang wiederzugeben, den sie aus mancherlei Gründen weithin verloren hat.
Erinnern wir nur an das Wort des hl. Ambrosius: Christus in ecclesia cantat. Das im Gottesdienst gesungene Wort wird zum Symbol und zur Erscheinung des göttlichen Logos, dessen Mysterium der Inkarnation sich fortsetzt.
Aus: Johannes Overath, Anmerkungen zur Theologie der Musica sacra: Musica spiritus sancti numine sacra, Beiträge zur Theologie der Musica Sacra, Città del Vaticano 2001, S. 104-112.